Weiter Bücher von Richard Heinrich:
Verzauberung, Methode und Gewohnheit

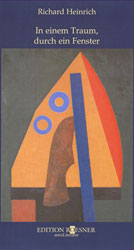 |
Richard Heinrich In einem Traum, durch ein Fenster RomanRomanTitelbild: Herbert Pasiecznyk 2002, 136 Seiten, franz. Broschur, 17,90 € (A), 17,40 € (D) ISBN 978-3-902300-04-1 |
Buchinfo · zur Person · Rezensionen
Buchinfo
Es befiel ihn die kindische Befürchtung, seine ganze Philosophie könnte einfach ungültig sein, lächerlich verpatzt, und einen Augenblick lang wollte er beten, daß Gott es so sein lassen möge wie er bewiesen hatte, daß es war; er schämte sich aber dieser Versuchung und sagte laut: ‚Ich bete nicht für einen Beweis.
Einer liegt schlafend im Bett und sieht sich im Innenraum seines Traums humpelnd einen Platz überqueren. Ein anderer beobachtet durch ein geschlossenes Fenster, wie jemand mit seltsamen Bewegungen einen Platz überquert und steht vor der Frage, ob das auf innere Gründe zurückzuführen ist - oder einfach auf die äußere Einwirkung eines heftigen Sturms.
Diese zwei Zitate, etwa dreihundert Jahre voneinander entfernt, stehen dem Roman voran, der als Versuch, ihre paradoxe Verflechtung zu lösen, angelegt ist. Dabei werden durch immer neue Umkehrungen von innen und außen, durch die allmähliche Annäherung, die Begegnung, die Vertauschung und die erneute Distanzierung der beiden Protagonisten eine Vielzahl von kleinen Geschichten, Fragmenten und dramatischen Elementen aufgewirbelt.
Befremdlich imaginäre Räume entfalten sich in dieser im Ton einer Farce gehaltenen schemenhaften philosophischen Auseinandersetzung, die nach und nach die Form einer Satire des männlichen Denkens - als Abfolge mehr oder weniger feierlicher Zusammenbrüche - annimmt.
Was das Besondere des Romans von Richard Heinrich ausmacht, ist die stets präsente, aber dennoch zumeist im Verborgenen angelegte Installation von Gedanken der beiden Protagonisten René Descartes und Ludwig Wittgenstein – sowie niemals benannten Satzfragmenten, Bildern oder Ideen von Vladimir Nabokov, Alfred Hitchcock, Marcel Proust, Walter Serner, Arthur Rimbaud ...
Kein Detail ist erfunden, alles ist verfälscht.
Es hätte dann das Unverständnis Macht im Verstand selbst, und wir könnten uns auch in vollendeter Klarheit täuschen: Wir vermeinen Licht in die Nacht ringsum zu werfen, in Wahrheit wächst Dunkelheit aus uns heraus.
zur Person
O. Univ.-Prof. Dr. Richard Heinrich: ist Professor am Institut für Philosophie der Universität Wien; lebt als Philosoph und freier Schriftsteller in Wien.
Mag. art. Herber Pasiecznyk (Titelbild): unterrichtet und lebt als freischaffender Künstler in Wien.
Rezensionen
"Zwischen Manie und Depression
René Descartes ist, fantasievoll angereichert, der Held eines Romans des in Wien lehrenden Philosophieprofessors Richard Heinrich
Nicht erst seit den sensationellen Erfolgen eines Umberto Eco oder eines Carl Djerassi boomt das Genre des ‚Professorenromans'. Ein solcher entsteht, wenn sich ein Gelehrter über das rein Fachliche hinaus von dem von ihm erforschten Thema angezogen fühlt und wenn er das Bedürfnis und vor allem die Fähigkeit besitzt, seine intellektuelle Obsession in einen narrativen Kontext zu stellen.
Richard Heinrich unterrichtet Philosophie an der Wiener Universität, und was für Umberto Eco die theologischen Disputationen des Mittelalters sind, ist für ihn die Frage, wie wohl eine Bilanz der Leistung des René Descartes dreieinhalb Jahrhunderte nach seinem Tod aussehen würde.
Wir treffen Descartes, oder doch wohl einen Wiedergänger, eine Personifikation des "ewigen Philosophen", eines Nachmittags in einer süddeutschen Kleinstadt der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts beim Joggen und werden einen Tag und zwei Nächte mit ihm verbringen. So steht es geschrieben, doch was nun wirklich Realität ist, stellt genau die Frage dar, an der sich weiland der Protagonist abgearbeitet hat und die Richard Heinrich seinem Lesepublikum zur Lösung aufgibt.
Sein Descartes gleitet schon beim Joggen in der Fantasie in die Wohnhäuser der Umgebung und verliert sich – und damit auch jenes ‚Ich', dessen Existenz er aus seiner Denktätigkeit abgeleitet hat – buchstäblich in den Reisen durch die Vereinigten Staaten, die Vladimir Nabokovs schuldbeladener Humbert-Humbert aus ‚Lolita' unternommen hat. Ganz offensichtlich stehen alle Ereignisse in einem ‚zähen Zusammenhang', doch die Aufklärung, was hier eigentlich geschieht, verweigert Richard Heinrich seinen Lesern.
Ein wohl kalkuliertes System von Anspielungen durchzieht den Text, doch ob es Lösungen bietet oder in Sackgassen führt, weiß bestenfalls der Autor. Hat jener obskure ‚Doktor der Philosophie', der uns Humberts Aufzeichnungen einleitet, auch hier seine Hand im Spiel? Oder hat der Professor Heudörfel Recht, wenn es sich auf die mit Kreativität scheinbar zwingend verbundenen Pathologien konzentriert? Und wo liegt die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit?
In jedem Fall: Diese Reise endet in Cambridge, Massachusetts, wo Descartes sein Ich wieder findet und im Gespräch mit einem geheimnisvollen – aber welche Figur in diesem Roman ist nicht geheimnisvoll? – Blinden lernt, dass erst die Blindheit die richtige Erklärung des Sehens liefert. War es diese subversive Erkenntnis, die den Zusammenbruch des René Descartes einleitet, den er bei einer eigenartigen Konferenz eines christlichen ‚Think-Thanks' unter dem zeitgeistigen Motto ‚Kraft des Denkens – Kraft der Erneuerung' erleidet?
Seltsames geschieht hier: Prominente werden von einem Geheimbund entführt, um ihren medialen Marktwert zu steigern und die angekündigte, intellektuell hochkarätige Veranstaltung schlägt in eine homoerotisch eingefärbte Orgie um. Descartes, der Skeptiker, der dennoch meint, eine Lösung gefunden zu haben, verschwindet und seine Stelle nimmt ein ‚ausländischer Taxifahrer' ein, der den Namen Ludwig Wittgenstein trägt und einen abrupten Ortswechsel nach Wien einleitet.
Scheinbar triumphiert Wittgenstein über Descartes, doch was jene ‚Lebenskunst' betrifft, der beide nachjagten, markiert er einen Rückfall. ‚Philosophen' haben ein gespaltenes öffentliches Image: Sie selbst erleben sich als eine Art Adelsstand unter den Intellektuellen und werden auch gelegentlich so gesehen. Doch es gibt auch das öffentliche Bild vom Philosophen, der außer Stande ist, den buchstäblichen Nagel einzuschlagen.
Heinrichs Protagonisten philosophieren auf hohem Niveau und scheitern auf demselben im Leben. Das allerdings ist kein privates Problem: Die Philosophie, so die letzte Erkenntnis Wittgensteins, ist ein ärgeres Übel als die Eifersucht: ‚Ihre Folter schont keine lebendige Regung, den Trost des Werkes gewährt sie nicht.' Manie und Depression markieren die beiden Pole, zwischen denen das Leben derer abläuft, die ihre alltäglichen Zweifel im Korsett der Philosophie zu bewältigen suchen. Als Erzähler und Philosoph ist Richard Heinrich beiden Polen gerecht geworden: In seinem ‚Roman' findet sich genauso eine Grundschule fundamentaler Fragen westlichen Denkens wie eine akribische Beschreibung von dessen Blamage.
Viele ‚Professorenromane' sind unerträglich ernsthaft – Heinrichs Beschreibung, wie seine Protagonisten versuchen, die Balance zu wahren, ist hingegen gelegentlich von einer überbordenden Komik."
Alfred Pfabigan (Salzburger Nachrichten, 22. März 2003)